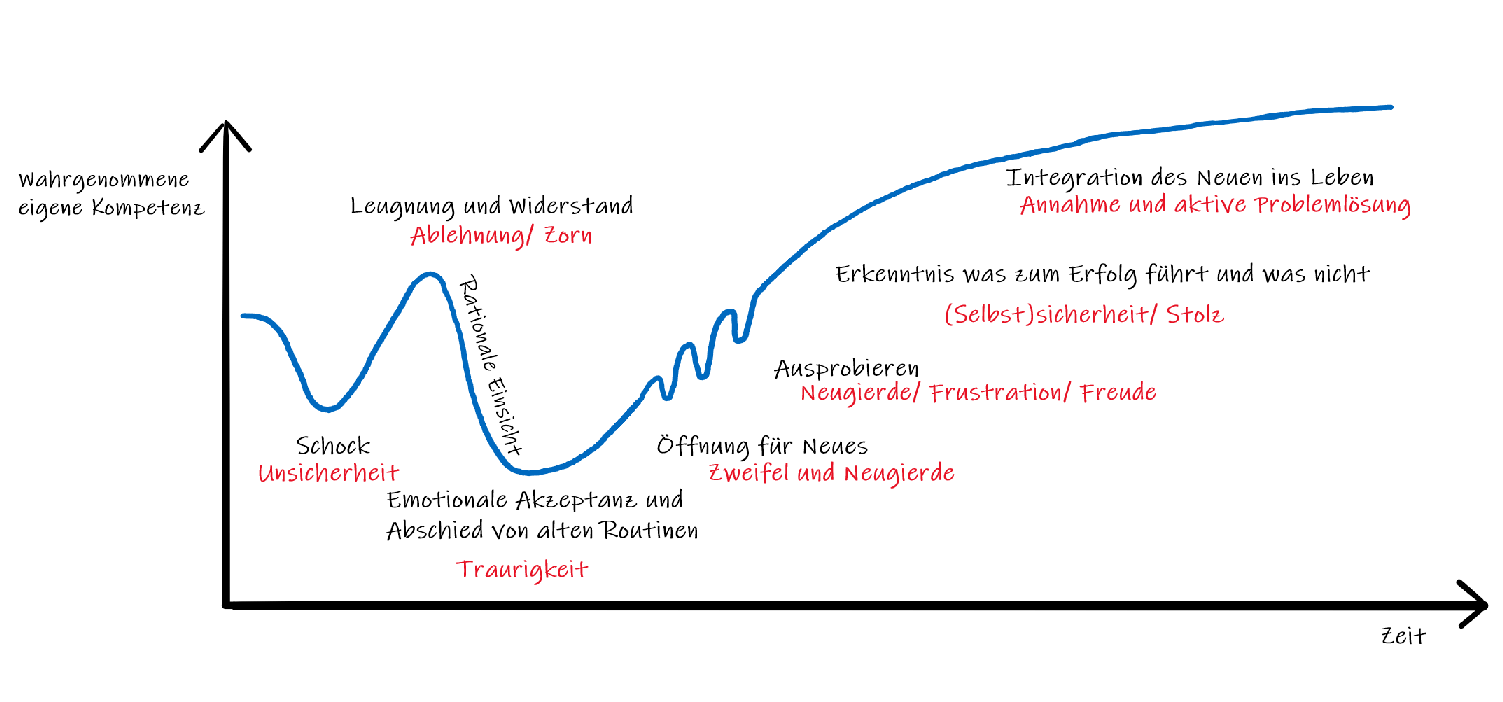Aufklärung - Medienbeiträge über Zöliakie - Mit anderen über die Erkrankung sprechen
Die Fähigkeit, angemessen über die Zöliakie sprechen zu können, ist eine grundlegende Kompetenz, die bei vielen Betroffenen stark mit dem Wohlbefinden zusammen hängt.
In Fragebögen zur Erhebung des gesundheitsbezogenen Wohlbefindens von Zöliakie-Erkrankten findet sich die Kommunikationskompetenz immer wieder als ein Merkmal wieder, welches gemessen wird.
Eine Herausforderung/Aufgabe, die die Zöliakie mit sich bringt ist, anderen die auf den ersten Blick nicht sichtbare Erkrankung zu erklären.
Vor allem in Essenssituationen, aber auch in sozialen Zusammentreffen im Allgemeinen, müssen Betroffene bestimmte Vorkehrungen treffen. Sie müssen auf Inhaltsstoffe und Kontaminationsrisiken achten und daher immer wieder erklären, warum sie etwas fragen, etwas reinigen oder ablehnen müssen.
Diese Aufgabe fällt manchen schwer, da sie bedeutet, sich in Situationen "outen" zu müssen, im Mittelpunkt zu stehen, für zu penibel gehalten zu werden und weil sie befürchten sich Zweifeln, Widersprüchen oder Versuchungen aussetzen zu müssen. Die einen halten es für unangemessen die ersten persönlichen Kontakte gleich mit einer persönlichen Information über die eigene Erkrankung zu beginnen. Die anderen empfinden die Erklärung der Symptomen als unangenehm.
Dem gegenüber stehen all die Vorteile, die eine transparente Kommunikation mit sich bringt. Wenn Betroffene frühzeitig davon erzählen, dass sie in Essenssituationen bestimmte Regeln einhalten müssen, kann das Missverständnisse vorbeugen und auch das Risiko reduzieren, sich in unangenehmen sozialen Situationen wieder zu finden, weil man zum Beispiel beim ersten Teamessen mit den Kollegen das Restaurant aussuchen möchte oder vor Ort länger mit dem Koch sprechen muss oder den gut gemeinten glutenfreien - doch vermutlich kontaminierten Kuchen - des Kollegens nicht essen darf. In vielen Situationen haben ich schon feststellen können, dass eine kurze und selbstbewusste Erklärung der Situation vor allem auf Verständnis und Interesse gestoßen ist. In Situationen, in denen ich mich nicht erklärt habe, entstanden z.T sozial anstrengende, manchmal auch lustige Situationen, aber auch mal Kontaminationsrisiken.
Beispiele, wo fehlende Kommunikation zu sozialen Herausforderungen geführt haben:
- Ein hochrangiger Vorgesetzter von mir - der mein Anliegen versucht hat in seinen engen Zeitplan unterzubringen - hielt es für unhöflich, dass ich sein Angebot das Dienstgespräch während des Mittagessens zu halten abgelehnt habe.
- In einem anderen Moment hat mein Interesse an einer glutenhaltigen Krokette meines Gegenübers dazu geführt, dass diese Krokette beinahe auf meinem Teller gelandet wäre, hätte ich diesen nicht mit einem Aufschrei des Schreckens schnell weggezogen, sodass die Krokette auf dem Tisch gelandet ist.
Beide Situationen hätte ich durch die kurze Information, dass ich durch Nahrungmittelunverträglichkeiten sehr aufpassen muss, wo und was ich esse vorbeugen können.
Um sich selber wohl zu fühlen, Entscheidungen ohne sozialen Druck fällen zu können und auch damit andere auf den Betroffenen Rücksicht nehmen können, ist es hilfreich, zumindest kurz zu äußern, dass die Zöliakie der Grund für bestimmte Regeln und Verhaltensweisen ist, die man als Betroffener umsetzen muss.
Für alle die, die den eigenen Erklärungen eine offizielle Information beifügen möchten, empfehle ich die folgenden Beiträge. Sie sind kurz und bündig, fundiert und auf diese Weise eine gute Basis für persönliche und damit individuelle Gespräche im Anschluss.
Über Zöliakie - Für Kinder
In der "Sendung mit der Maus"
wird die Zöliakie einfach und wissenschaftlich in 9 Minuten für Kinder erklärt.
Dieses Video verdeutlicht:
- Wie die Schritte zur Diagnose sind (Arztgespräch und Biopsie).
- Dass es zu einer körperlichen Schädigung (an den Darmzotten) kommt, wenn ein Zöli Gluten zu sich nimmt.
- In welchen Getreidesorten Gluten ist.
- Was ein Kind wissen muss, um im Alltag entscheiden zu können, was es essen kann und was nicht. Hier wir dies anhand der Listen der DZG erklärt und auch über das Lernen der 15 verbotenen Zutaten, um die Zutatenlisten zu prüfen.
- Dass auch Pflegeprodukte glutenfrei sein müssen.
- Wie viel 125 mg Mehl (20 mg Gluten) sind. Hier befindet sich ein Fehler: Das tägliche Limit liegt sogar bei nur 10 mg.
- Kontamination vermeiden in der Küche und Essensituationen.
Psychologische Aspekte:
- Dass man keine Angst vor der Untersuchung haben braucht.
- Dass die glutenfreie Diät eine erhebliche Einschränkung der Vielfalt an Lebensmittel und besondere soziale Situationen bedeutet, weil z.B. alle Produkte einer Bäckerei tabu sind oder der Besuch in der Eisdiele bedeutet, dass die Betroffenen lernen müssen, mit Verzicht umzugehen und immer eine gute wertvolle Alternative zu finden. Das kann für Betroffene jeden Alters sehr schwer sein.
Im Video sieht man aber auch, dass die Bewertung der Situation einen enormen Einfluss darauf hat, ob die Freude an der gemeinsamen Aktion und dem sozialen Miteinander oder die Schwere durch den Verzicht überwiegt.
- Es ist nicht hilfreich in diesen Situationen immer den Vergleich mit früher oder gleichwertigen Lebensmitteln zu ziehen. Wird die Situation als Gegeben akzeptiert, kann viel leichter nach guten Alternativen gesucht werden.
Ein resilienter Umgang zeigt sich darin, das soziale Miteinander und die glutenfreie Alternative dankbar zu genießen.
Gleichzeitig der resiliente Fokus auf all die Lebensmittel, die Betroffene essen können und der positive Blick auf den großen Einfluss, den Betroffene auf den Krankheitsprozess haben, den sie allein durch ihre Diät und ohne Medikamente steuern können!
Über Zöliakie - Für Erwachsene
Im Erklärvideo des Projekts "Fokus IN CD"
(Internationale Zusammenarbeit zur Aufklärung für Betroffene, Ärzte und Ernährungsberater)
wird die Zöliakie in 3 Minuten kurz und allgemein erklärt. Es eignet sich wunderbar, um es als erste Information an Freunde, Familie, Kollegen oder Personal zu schicken, welches betroffene Kinder betreut.
Dieses Video verdeutlicht:
- Dass es sich um eine Autoimmunkrankheit handelt.
- Dass Gluten in Getreide steckt.
- Die Häufigkeit der Erkrankung.
- Welche Faktoren zusammen kommen müssen, um eine Zöliakie zu entwickeln.
- Was bei der Einnahme von Gluten im Körper passiert.
- die typischen Symptome aber auch, die vielfältigen Beschwerdebilder, die die Zöliakie auslösen kann, wenn die Diät nicht eingehalten wird.
- Es gibt auch Betroffene ohne Symptome. Es lässt sich ein dezenter Hinweis erkennen, dass Familienangehörige getestet werden sollten, um zu verhindern, dass weitere Betroffene in der Familie unerkannt bleiben.
- Wie der Prozess der Diagnostik ist.
- Dass vor der Diagnose keine glutenfreie Diät gehalten werden darf, um die Krankheit erkennen zu können.
- Dass die einzige Behandlung die glutenfreie Diät ist, die zur Verbesserung der Beschwerden und Gesundheit führt.
Psychologische Aspekte:
- Neben den gastrointestinalen Symptomen werden hier auch psychologische Symptome wie Stimmungsschwankungen und Depressionen genannt.
Über Folgeerkrankungen bei unentdeckter Zöliakie oder Diätfehlern - 2 Beispiele
Diese beiden Videos verdeutlichen:
- Wie lang der Weg zur Diagnose bei manchen war.
- Warum man Zöliakie den "Chamäleon der Erkrankungen" nennt, da viele Ärzte bei Symptomen wie Migräne, Osteoporose und Entzündungen jeglicher Art nicht an Zöliakie denken.
- Wenn die Zöliakie unentdeckt oder unbehandelt bleibt, sind Folgen möglich, die zum Teil sogar irreversibel sind.
- Die unterstützende Arbeit der Deutschen Zöliakie Gesellschaft (DZG), die ihre Mitglieder tatkräftig bei der Umstellung in ein glutenfreies Leben unterstützt.
- Eine von Dr. med. Gunter Burmester (Altonaer Kinderkrankenhaus) vermutete hohe Dunkelziffer von 9 unerkannten Zöliakie-Erkrankungen auf jede diagnostizierte Person.
Psychologische Aspekte:
- Dass es wichtig ist, mit Hartnäckigkeit weiter nach der Ursache zu suchen, auch wenn die Ärzte ratlos sind und daher sagen, dass man sich die Beschwerden einbildet.
- Dass der Körper selbst nach jahre- und jahrzentelanger glutenhaltiger Ernährung ein riesiges Potential zur Heilung hat!
- Wie belastend die Suche nach den Gründen für die schlechte Gesundheit nicht nur für die Betroffene, Frau Christel Speth, sondern auch für die Angehörigen, wie ihren Mann, der all die Sorgen und Unsicherheiten mitgetragen hat.
- Beim unteren Video "Eine Hamburgerin kämpft gegen Zöliakie" sehen wir ein beeindruckendes Beispiel von Katinka Reichelt, einer Betroffenen, die trotz Zöliakie und deren Folgeerkrankungen ihre ambitionierten Ziele verfolgt und diese mit einer eigenen glutenfreien Backstube und Versand-Shop in 25451 Quickborn, (https://www.flourrebels.com/), umsetzt.
Portrait von Christel Speth, die auf Grund der unerkannten Zöliakie immer mehr Gewicht verlor, bis sie endlich ihre Diagnose erhielt und sich nun wieder gesund fühlt.
Portrait der gf-Gourmet-Bäckerin aus der Nähe von Hamburg.
Eine Betroffene, die die Folgeschäden der unbehandelten Zöliakie erlebt hat.
Übers Brot backen:
In dieser Sendung "Quarks" "Besser Brot backen"
- Wie schwierig das Brot backen ist, da die Backeigenschaften glutenfreier Mehle das Backen deutlich komplizierter machen.
- Dass die Beschaffenheit, Geschmack, Viskosität etc. eines glutenfreien Brotes von vielen einzelnen Faktoren abhängen (Menge und Temperatur des Wassers, Mehlsorten, Dauer und Temperatur bei der Gärung, Gefäße, Form des Brotes) die die ersten Backversuche daher für viele so anstrengend machen.
- Dass die Erkrankung einen zeitlichen Mehraufwand im Alltag bedeutet, die die Betroffenen (Familien) einplanen müssen und für Ausgleich sorgen sollten.
- Dass nicht jeder bereit ist, diesen Aufwand zu leisten. Dann verzichtet man auf solch qualitatives Brot oder aber kauft/bestellt es von diesen besonderen und damit noch seltenen Bäckereien.
Ein Beispiel einer Person, die sich durch die Auseinandersetzung mit Zöliakie ein sehr hohes Ziel gesetzt und erreicht hat.
- Ein Beispiel sich wie ein Ziel entlang der Bedürfnishierarchie (nach Maslow) entwickelt hat: Der Ursprung des Motivs war ganz grundlegend, nämlich schmackhaftes Brot essen zu können. Nach vielen misslungenen Versuchen, berichtet sie davon, alle Zusammenhänge verstehen zu wollen. Durch das fachliche Lernen und die formale Qualifikation konnte sie sich in einem neuen Beruf, die sie wie eine Berufung beschreibt, selbstverwirklichen.